Klientelpolitik par excellence: Pünktlich zum Berliner „Christopher Street Day“ präsentierte der Senat 92 Maßnahmen für die LSBT-Community. Mit weitreichenden Folgen für die Stadt.
Hielt vor etwa 20 Jahren Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe in die deutsche Politik und Verwaltung Einzug, so geschieht dies nun mit LSBT-Themen, allerdings in allen Lebensbereichen. Am 24. Juli verabschiedete der Berliner Senat für die Initiative „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ (IGSV) 92 Maßnahmen, die große Auswirkungen auf Berlin und seine Bürger haben werden.
So beispielsweise in der Bildungsarbeit. Zukünftig soll die „Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ in Berliner Schulen, Jugendeinrichtungen und Sportvereinen vermehrt thematisiert und gefördert werden (Maßnahmen 1, 7, 31, 32). Lehrer und pädagogische Fachkräfte sollen an entsprechenden Weiterbildungen teilnehmen, schulische Lehrpläne überarbeitet, geschlechtsneutrale Toiletten eingeführt und „Beschwerde- sowie Hilfs- und Unterstützungsstrukturen“ für „LSBTI-Kinder“ ausgebaut werden (65–77).
„LSBTI-Geschichte“ soll in schulischen Lehrplänen, Museen, kulturellen Einrichtungen, Volkshochschulen, der politischen Bildungsarbeit, an Gedenkorten, im Stadtbild und als Teil der Tourismusstrategie eine wichtigere Rolle als bisher einnehmen (46ff). LSBT-Projekte, die ihm Rahmen der „Pride Weeks“ stattfinden, sollen besonders gefördert werden (88f).
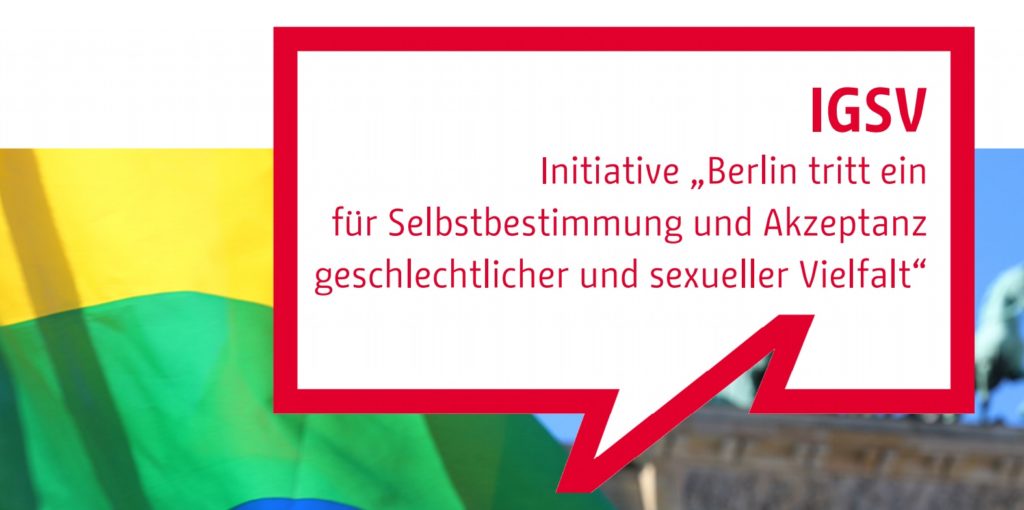
„Sensibilisierung“ und „Empowerment“ in allen Bereichen
Die Autoren des Maßnahmenkatalogs verpflichten Hochschulen zu eigenen „Diversity Policies und Strategien“ (26), die Polizei zu „Sensibilisierungsmaßnahmen“ in Form von Workshops (14, 33) und landeseigene Unternehmen wie die Verkehrsbetriebe oder Stadtreinigung zu einer „LSBTI-sensiblen“ Öffentlichkeitsarbeit (6).
Generell wird sehr häufig von „Sensibilisierung“ und „Empowerment“ gesprochen: „Empowermentworkshops“ sollen eingeführt werden (12, 22, 24), „Arbeitgebende“ sollen für die Belange der LSBT-Community sensibilisiert werden und den Arbeitsplatz für diese „inklusiver und attraktiver“ gestalten (29). Außerdem soll man für das „Empowerment von LSBTI-Arbeitnehmenden“ die Einrichtung „eines intersektional ausgerichteten Mentoring-Programms“ prüfen, das vor allem „Lesben sowie transgeschlechtliche und nicht-binäre Menschen“ in ihrem Coming-Out und ihrer Karriereplanung unterstützt (30).
Die städtischen Verwaltungsbehörden bleiben natürlich nicht verschont: Von einem „Diversity-Landesprogramm“ samt Netzwerk von „Diversity-Ansprechpersonen“ und Präsenz auf LSBT-Karrieremessen ist die Rede (78–83). Ebenso von LSBT-Antidiskriminierungsberatungsstellen, einer „Fachstelle für die Belange von trans- und intergeschlechtlichen sowie nicht-binären Menschen“ (21) sowie der Aufnahme von LSBT-Organisationen in zahlreiche öffentliche Gremien, wie zum Beispiel dem Landesjugendhilfeausschuss, Landesschulbeirat, Erwachsenenbildungsbeirat, rbb-Rundfunkrat und der Ethikkommission der Ärztekammer (91).
Queerpolitik statt Familienpolitik
Doch die Maßnahmen beschränken sich nicht auf die Landespolitik. Der Berliner Senat kündigt außerdem mehrere Initiativen auf der Bundesebene an, zum Beispiel die Weiterentwicklung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG), die Reform des Abstammungsrechts und die Einführung von „Mehrelternschaften“ (92).
Der Maßnahmenkatalog des Berliner Senats offenbart, dass es dabei nicht einfach um den Abbau etwaiger Diskriminierungen geht, sondern um eine tiefgreifende Umgestaltung des öffentlichen Lebens. Der gesellschaftlichen Mehrheit wird die Ideologie einer Minderheit aufgezwungen. Aus seiner Klientelpolitik macht Dr. Dirk Behrendt, Berliner Justizsenator und Mitglied der Grünen, keinen Hehl. Im Gespräch mit der „taz“ sagt der Verantwortliche der Initiative offen: „Wir erheben den Anspruch, umfassende Queerpolitik für die Regenbogenhauptstadt Berlin zu machen. Hier hatten wir schon früh Ansprechpartner für LGBTI bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Wir werben dafür, dass das Schule macht. Wir wissen, dass wir eine große und vielfältige LGBTI-Community in der Stadt haben, und für die machen wir Politik.“
Queerpolitik statt Familienpolitik. Der Senat der „Regenbogenhauptstadt“ Berlin macht seinem fragwürdigen Namen alle Ehre. Kritische Stimmen aus Politik oder Medien sind bislang nicht zu vernehmen.
